
Geschichtsprojekte
Wir sammeln Stadtgeschichte(n)
Unter dem Motto „Was oder wer hat Bernau verändert?“ läuft ein Projekt des Vereins zur Bereicherung der Stadtgeschichte. Idee und künstlerische Umsetzung stammen von der israelischen Soziokünstlerin Ofri Lapid. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe interessierter Heimatgeschichtler wurden 12 Postkarten zu verschiedenen Themen geschrieben und gestaltet. Sie liegen zum Mitnehmen in öffentlichen Einrichtungen (u.a. Bibliothek, Galerie, Touristinfo, Museum) aus. Auf leeren Exemplaren können dazu Kommentare oder weitere Episoden geschrieben werden und damit Stoff für weitere Postkarten bilden. Gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung.
Schulprojekte zur Bernauer Geschichte
Für Projekttage an Schulen wurden die Themen „Hexenverfolgung“, „Georg Rollenhagen“ und „Jüdische Spuren“ entwickelt und erprobt. Sie können weiterhin gebucht werden.

Publikationen
Postkarten zur Bernauer Geschichte Aufruf zum Geschichte schreiben als pdf
Kalender „Romantische Barnimer Blicke“
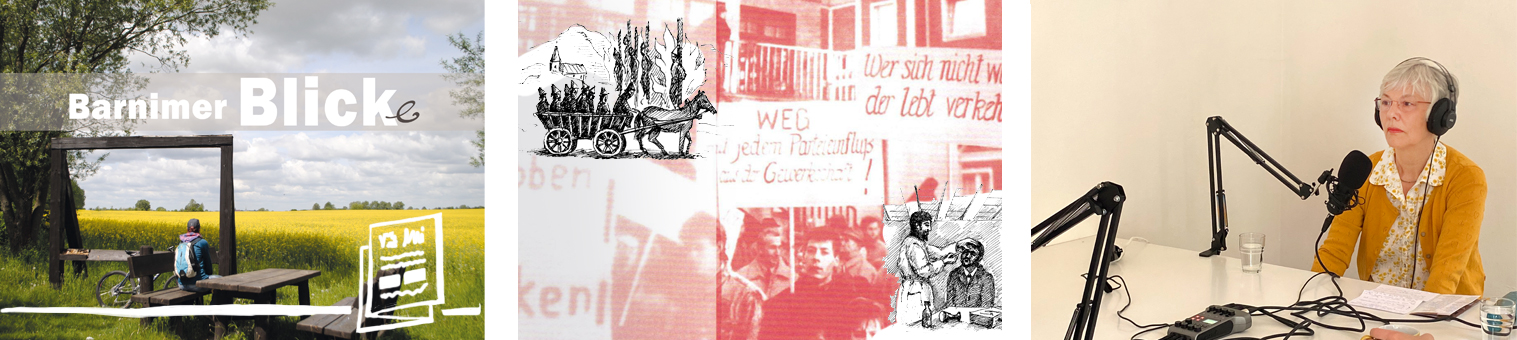
Vereinsarchiv
Hexenverfolgung in Bernau
Annelie Grund schuf 2005 ein Denkmal, das an die Hexenverfolgung in Bernau vor 400 Jahren erinnert. Dr. Birgit Schädlich begleitete den Prozess der Diskussion und Einweihung mit Nachforschungen, Veranstaltungen und einem Flyer. Sie entdeckte Korrespondenzen zwischen der Stadt Bernau, dem Königshof und der Universität Viadrina, die sie mit fachkundiger Hilfe entschlüsselte. Die Fakten daraus bilden Grundlage für ein Rollenspiel, das bei Schulprojekten und anderen Veranstaltungen aufgeführt wurde. Es schildert exemplarisch das Schicksal der Dorothea Meermann, deren Familie von der Großmutter bis zur Enkelin Opfer der Hexenverfolgung in Bernau wurde.
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Meermann ↵
Jüdische Spuren in Bernau
Im Jahr 2000 beschäftigte sich die damalige Jugend-Geschichtswerkstatt mit den Zeitzeugnissen jüdischen Lebens in Bernau. Sie fand Spuren in den Archiven, im Jüdischen Museum Berlin, in Chroniken und bei Zeitzeugen. Ihre Erkenntnisse hielt sie in einem Stadtspaziergang fest, den sie auch nieder schrieben. Faltblatt Jüdische Spuren in Bernau als pdf.Konrad Wolf in Bernau
2001 gingen die Jugendlichen der Geschichtswerkstatt dem Wirken von Konrad Wolf, einem der bekanntesten DDR-Filmregisseure, in Bernau nach. Dieser war 1945 für zwei Tage als Kommandant der Roten Armee in Bernau eingesetzt und hielt dies in seinem Film „Ich war 19“ fest. Er wurde später Ehrenbürger von Bernau und förderte die Stadt auf verschiedene Weise. Die jungen Historiker/innen holten eine Ausstellung über sein Wirken vom Dachboden des Heimatmuseums, stellten diese in der Galerie aus und luden dazu den einstigen Freund von „Koni“, Wladimir Gall ein. Als ein Höhepunkt zur Forschung dieser Thematik gestaltete sich ein Interview mit dem Bruder und einstiegen Stasi-Chef der DDR, Markus Wolf, in dem er über seine Familie erzählte. Alle Ergebnisse liegen in einer Sammelmappe des Projektes vor.Entstehungsgeschichte des Bernauer Puschkinviertels
Im Rahmen seines Freiwilligen Kulturellen Jahres beim bbz beschäftigte sich Falko Weigelt 2002 mit dem Aufbau eines Stadtviertels in den 1940er bis 90er Jahren. Sein Abschlussergebnis gestaltete er als Flyer und Powerpoint-Präsentation. Beides liegt zur Einsicht im bbz vor.Umweltverschmutzung durch das Schichtpressstoffwerk Bernau
Das Schichtpressstoffwerk (SPW) war bis 1994 der größte Arbeitgeber von Bernau. Im Rahmen des Bundesgeschichtswettbewerbes 2010/11 beschäftigte sich Switlana Steingart in ihrem Beitrag „Geheimgehaltene Umweltverschmutzung in Bernau – was hatte es mit dem SPW auf sich?“ mit der Problematik und deren Verschleierung bzw. Aufdeckung durch Bürgerinitiativen in der Umbruchzeit der DDR. Sie erhielt dafür einen der fünf Landespreise. Hier die Dokumentation "Geheim gehaltene Umweltverschmutzung in Bernau – was hatte es mit dem SPW auf sich?" pdf-Ansicht - 2,01 MB.Geschichte des Heeresbekleidungsamtes am Schönfelder Weg in Bernau
Im Rahmen des geförderten Jugendgeschichtsprogrammes „Zeitensprünge“ entstand in Kooperation mit dem Verein Panke-Park-Kulturkonvent 2012 ein Dokumentarfilm zur Geschichte des Kasernengeländes. Dieses Objekt lag damals brach und der Verein Panke-Park setzte sich für eine zivile Nutzung des Geländes ein. Heute sind daraus ein neues Stadtquartier und der Pankepark entstanden. Die Jugendlichen haben ein wichtiges historisches Zeitzeugnis erarbeitet. Hier der Kurzfilm Zeitensprünge. Kasernengeschichten - Die Geschichte des ehemaligen Heeresbekleidungsamtes Bernau." ↵"Als Bernau sein Gesicht verlor" - über den Stadtkernabriss 1975
Im Jahr 1998 widmete sich die Jugend-Geschichtswerkstatt dem Abriss der Altstadt von Bernau und ging der Frage nach, warum die Fachwerkhäuser den Plattenbauten weichen mussten. Sie lösten mit ihrem Ergebnis "Als Bernau sein Gesicht" verlor heftige Diskussionen aus, in denen einige der damaligen Verantwortlichen den Abriss vehement verteidigten und die Einschätzungen der Geschichtswerkstatt abwerteten. Die zusammengetragenen Fakten jedoch waren der Ausgangspunkt für eine differenziertere Beurteilung dieser einschneidenden Veränderung in der Stadtgeschichte von Bernau. Mehrfach wurde das Thema aufgegriffen und öffentlich bearbeitet. Die Geschichtswerkstatt stellte ihre Ergebnisse dafür zur Verfügung. Sie reichte den Beitrag beim Bundesgeschichtswettbewerb ein und erzielte einen 5. Preis. Die Dokumentation kann im bbz eingesehen werden.Über Kriegswaisen in den Hoffnungstaler Anstalten Lobetal
1996 gingen Jugendliche der Geschichtswerkstatt des bbz den Schicksalen von Waisenkindern des Zweiten Weltkrieges nach, die in Lobetal aufgenommen wurden. Sie erhielten mit dem Video „Die Kinderheimer von Lobetal“ einen 2. Preis beim Bundesgeschichtswettbewerb. Der Videofilm kann über die Körberstiftung Hamburg eingesehen werde.Das Zentrale Aufnahmeheim Röntgental (ZAH)
Mit der Recherche zum einstigen ZAH landete die Jugendgeschichtswerkstatt des bbz ihren ersten öffentlichen Erfolg. Das Thema des Bundesgeschichtswettbewerbs „Ost-Westgeschichten“ veranlasste sie dazu, die Geschichte des Areals aufzuspüren. Die Übersiedlung von Westdeutschen in die DDR erregte großes mediales Interesse. Archive, Zeitungsberichte und vor allem Zeitzeugeninterviews bildeten die Grundlage des Videofilmes „Wo bitte geht´s in die DDR?“. Da sich viele Zeitzeugen für Filmaufnahmen nicht zur Verfügung stellten, spielten die Jugendlichen diese einfach selbst nach. Sie erhielten für ihren Beitrag einen 5. Wettbewerbspreis. Er kann über die Körberstiftung Hamburg eingesehen werden. Bis heute hält das Interesse am Thema an. Mehrere Zeitzeugen haben sich danach noch gemeldet und das Bild von der Einrichtung vervollständigt. Die wichtigsten Fakten sind hier als ZAH-Dokumentation zusammengefasst. Weitere Publikationen dazu u.a. „Wo bitte geht´s in die DDR?“ in: Geschichte bewegt, edition Körber-Stiftung 2006 und Ulrich Stoll: Einmal Freiheit und zurück.
Vereinsgeschichte
Vorstand: Karsten Hille (Vorsitz), Dr. Hannelore Eberlein, Dr. Birgit SchädlichPowerPointPräsentation 20 Jahre bbz 1990-2010 als pdf 7Mb
Ab 2000
- 10-jähriges Jubiläum
- Vortragsreihe zu Geschichte, Religion und Politik in der Galerie Bernau u.a. mit Prof. Dr. Carl Jürgen Kaltenborn
- Vorträge zur Frauengeschichte in der Region in Zusammenarbeit mit Dr. Beate Neubauer (Berlin)
- Ausbau der Deutschkurse zu einem ganzjährigen Angebot mit eigenem Konzept durch Margrid Posselt
- Schulprojekte „Keine Angst vor Fremden“ zum Kennenlernen von Immigrant*innen aus der Region in Zusammenarbeit mit Deutschkursteilnehmer*innen des bbz
- Englisch für Fortgeschrittene
- Spanisch für Anfänger
- Fachhistorische Begleitung der Initiative für ein Denkmal zur Hexenverfolgung in Bernau
- Erste Patenschaft zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund durch Siegie Wöhler
- Jugendschreibwerkstatt holt Preise beim Jugendliteraturwettbewerb
- Projekt „Zeitzeugen der Landwirtschaft“ in Zusammenarbeit mit dem Agrarmuseum Wandlitz und Dr. Claudia Schmid-Rathjen
- Schulprojekte: Hexenverfolgung in Bernau
- Schulprojekt „Kinderstadtreporter“ (Grundschule an der Hasenheide)
- Schulprojekt „Origami“ und „Rollenhagen“ (Rollenhagen-Grundschule)
- Schreibwerkstatt und Schulprojekte zur DDR-Geschichte
- Projekt „Aktiv im Alter“ für Immigrantinnen (Exkursionen, Vorträge, Erzählcafé)
- Einführung von Online-Unterricht für die Deutschkurse durch Margrid Posselt
- Buchprojekt der Schreibwerkstatt „Barnimer Blicke“
- Ausbau der Bildungspatenschaften für Kinder mit Migrationshintergrund
- Projekt „Heimat im Umbau"
bis 1999
- Jugendbildungsstelle über den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten für die Jugend- Geschichtswerkstatt; Teilnahme an Bundesgeschichtswettbewerben (5. und 2. Preise)
- Anerkennung als Weiterbildungsträger im Land Brandenburg; Gründungsmitglied des regionalen Weiterbildungsrates
- Berufsorientierungsseminare für Jugendliche
- Gründungsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft politisch kulturelle Bildung, langjährige Mitarbeit im Vorstand der LAG
- Anerkennung als Freier Träger der Jugendhilfe im Landkreis Barnim
- Erzählcafès zur Bernauer Geschichte
- Frauenschreibwerkstatt, Biografisches Schreiben, Jugendschreibwerkstatt
- Fotowerkstatt schwarz/weiß Fotografie; verschiedene Ausstellungen in Bernau
- Deutschkurse für Spätaussiedler*innen und jüdische Kontingentflüchtlinge
1994
- Standortwechsel nach Bernau (heutiger Standort)
1992
- Frauenseminare für die neugewählten Gleichstellungsbeauftragten
- Begegnungsseminare mit westdeutschen Arbeitnehmer*nnen
- ABM „Lebensgeschichtliche Interviews von Bernauer*innen“
1990
- Gründung mit dem Ziel, politisch unabhängige, arbeitnehmerorientierte Bildung anzubieten
- Standort war heutiger Bauhaus-Campus Bernau
- Personal-, Jugendvertretungs- und Betriebsräteschulungen


